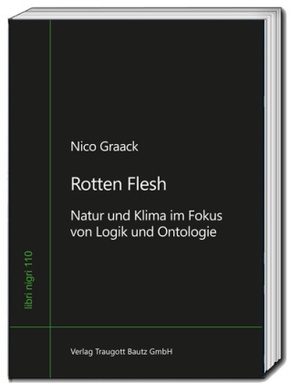Der philosophische Teil des ökologischen Diskurses ist überfrachtet von einem alten, romantischen Topos: Der Mensch habe sich von einer ursprünglichen Verwurzelung im Absoluten der Natur entfremdet, darin die Ausbeutung derselben ermöglicht, und nun gelte es, diese Verwurzelung wiederherzustellen. Eine seiner heutigen Formen findet sich in der Öko-Phänomenologie. Die These dieses Buches aber ist: Schon die Diagnose der ökologischen Katastrophe setzt jene "Entfremdung" voraus, gegen die die Öko-Mimesis vergeblich ankämpft. Über einen Paten der Öko-Phänomenologie, Merleau-Ponty, werden die Weichenstellungen dieses Diskurses rekonstruiert, die in den Problemen der Kantschen Transzendentalphilosophie ihren Anfang nehmen. Aber von Merleau-Pontys Frühwerk tun sich zwei Wege auf: Der eine führt über David Abram in den romantischen Topos. Der andere führt über den Begriff des Fleisches im Spätwerk zu Lacan. Dieser zweite Weg erlaubt Ansätze für einen anderen Begriff von Natur als denjenig en, den jener romantische Topos voraussetzt, und mündet in die These: "Natur" als Absolutes ist nur als lacansches "Nicht-Alles" denkbar. In einer minutiösen Entwicklung der logischen Struktur dieser lacanschen Kategorie mit Russell und Kant und ihrer ontologischen Lesart bei Zizek lässt sich in der Begründung dieser These hoffentlich das einleiten, was man den "ecological turn" der lacanianischen Theorie nennen könnte. Die ökologische Katastrophe zumindest fordert einen Ausweg aus den Sackgassen der Romantik.
Nico Graack hat Philosophie und Informatik in Kiel und Prag studiert und bereitet derzeit seine Promotion zu Lacans Logik und ihrer Interpretation in der Ljubljana Schule vor. Daneben arbeitet er als freier Autor und Journalist. Mehrere Artikel von ihm wurden zu Problemen einer von Lacan inspirierten kritischen Theorie, zu Zizeks Denken und zu Kant veröffentlicht, neben journalistischen und politischen Arbeiten.Beiträge von ihm erschienen u.a. im Philosophie Magazin und Deutschlandradio, in Jacobin, analyse & kritik, neues deutschland und Y - Zeitschrift für atopisches Denken. Er engagiert sich in verschiedenen Teilen der Klimabewegung. In Buchform erschienen außerdem bisher Wenn ich groß bin ,möchte' ich auch mal Spießer werden. Reflexionen von der Tankstelle (IPPKVerlag, 2023) und Wer schuldet hier wem etwas? Bullshit-Diskurse, Deutschland und Schuldenstreichung für den Globalen Süden (Westend Verlag, 2025, mit Robin Jaspert und Lara Wörner). Hans Rainer Sepp geb. am 9. September 1954 in Rottenbuch, Oberbayern ist ein deutscher Philosoph.Er studierte von 1974 bis 1979 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Philosophie und Germanistik. Er schloss sein Studium mit dem Magister Artium (M.A.) ab und war von1982 bis 1992 als Mitarbeiter des Husserl-Archivs der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg i. Br. bei Werner Marx Koeditor von Bänden der Gesammelten Werke Edmund Husserls (Husserliana).1991/1992 promovierte Sepp an der Universität München bei Eberhard Avé-Lallemant.2004/2005 habilitierte er sich an der Fakultät für Humanwissenschaften der Karls-Universität in Prag und an der Technischen Universität Dresden.Sepps Arbeitsgebiete sind vor allem: Phänomenologie, Ethik, Ästhetik, Interkulturelle Philosophie, Philosophische Anthropologie. Nach Untersuchungen zu den praktisch-ethischen Konsequenzen der phänomenologischen Veränderung des Weltbezugs am Beispiel des Problems der Grenze, der Bildstruktur und des Lebens begriffs beschäftigt sich Sepp vor allem mit dem Konzept einer "Philosophischen Europa-Forschung" und mit einer auf der Grundlage einer erneuerten Phänomenologie der Leiblichkeit erarbeiteten "Oikophilosophie".
Autorenporträt schließen