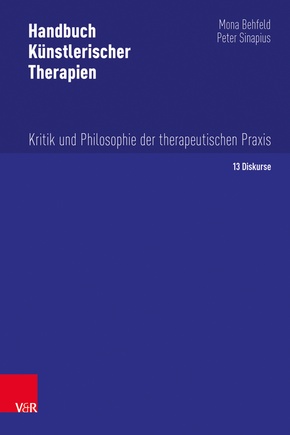Glaube und Gegenwart - Die Entwicklung der kirchenpolitischen Netzwerke in Württemberg um 1968. Dissertationsschrift
| Verlag | Vandenhoeck & Ruprecht |
| Auflage | 2016 |
| Seiten | 461 |
| Format | 16,8 x 23,6 x 3,6 cm |
| Gewicht | 904 g |
| Reihe | Arbeiten zur kirchlichen Zeitgeschichte, Reihe B 62 |
| ISBN-10 | 3525557779 |
| ISBN-13 | 9783525557778 |
| Bestell-Nr | 52555777A |
Karin Oehlmann beschreibt die Geschichte der theologischen und kirchenpolitischen Auseinandersetzungen, die die kirchenpolitische Landschaft in Württemberg formten, die in Gesprächskreise und Landesvereinigungen gegliedert und vom Gegensatz zwischen Pietismus und moderner Theologie geprägt ist.Die Auseinandersetzungen begannen nach dem Zweiten Weltkrieg und fanden im Konflikt um den Stuttgarter Kirchentag 1969 ihren massivsten Ausdruck. Vordergründig ging es in dem Konflikt um das Entmythologisierungskonzept Rudolf Bultmanns und seiner Schüler; gleichzeitig wurden damit aber auch die Machtverhältnisse in der Württembergischen Landeskirche neu austariert. §§Württemberg um 1968
Karin Oehlmann beschreibt, ausgehend von der heutigen kirchenpolitischen Landschaft in Württemberg, die in Gesprächskreise und Landesvereinigungen gegliedert und vom Gegensatz zwischen Pietismus und moderner Theologie geprägt ist, die großen Konflikte in der Landeskirche sowie die Geschichte der beteiligten Gruppen.Zunächst werden die Entstehungsgeschichten der Ludwig-Hofacker-Vereinigung (heute: Lebendige Gemeinde Christusbewegung in Württemberg), der Württembergischen Bekenntnisgemeinschaft (heute: Evangelium und Kirche) und jener progressiv und reformerisch orientierten Gruppen, aus denen später die Offene Kirche" hervorging, beschrieben. Grundlegend für die Entwicklung zwischen 1945 und 1965 war dabei der Konflikt um die sog. Moderne Theologie bzw. das Entmythologisierungskonzept Rudolf Bultmanns. Diese Theologie wurde von biblisch-konservativer Seite massiv bekämpft, während die reformorientierten Kräfte darin die angemessene Form theologischen Denkens und Verkündigens im 20. Jahrhundert sahen und sie verteidigten.Die Netzwerke, die sich um die theologische Frage der bekenntnisgemäßen Exegese gebildet hatten, suchen ihre Anliegen u.a. mit den Mitteln der Kirchenpolitik und über die Landessynode durchzusetzen. Dies führte zu einer Polarisierung der synodalen Arbeit, was 1966 in der Entstehung der "Gesprächskreise" in der Württembergischen Landessynode seinen klarsten Ausdruck fand.Im Vorfeld des Kirchentags 1969 spitze sich der Konflikt zwischen diesen Lagern massiv zu, da es um Teilnahme oder Boykott der pietistisch-evangelikalen Gruppen ging. Diese Auseinandersetzung führte im Herbst 1968 zum Rücktritt des Synodalpräsidenten Oskar Klumpp. Auf diesen Rücktritt reagierten die progressiven Kräfte in Württemberg mit der Gründung der "Kritischen Kirche", aus der später die "Offene Kirche" hervorging."
Ausgezeichnet mit dem Johannes-Brenz-Preis (2015)!
Karin Oehlmann describes the history of the conflicts that shaped church politics in Württemberg, which today are characterized by the presence of informal groups within the Church's General Assembly ("Landessynode"), and by the contrast between pietism and modern theology.
The conflicts began after the Second World War and reached their peak in the dispute concerning the Kirchentag in Stuttgart in 1969. The explicit point of conflict was the concept of demythologization by Rudolf Bultmann and his students, but at the same time, these conflicts influenced the balance of power in the church of Württemberg.