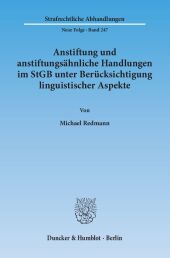Anstiftung und anstiftungsähnliche Handlungen im StGB unter Berücksichtigung linguistischer Aspekte. - Dissertationsschrift
| Verlag | Duncker & Humblot |
| Auflage | 2014 |
| Seiten | 372 |
| Format | 15,7 x 23,8 x 1,8 cm |
| Gewicht | 500 g |
| Reihe | Strafrechtliche Abhandlungen (SRA) Neue Folge 247 |
| ISBN-10 | 3428141350 |
| ISBN-13 | 9783428141357 |
| Bestell-Nr | 42814135A |
Unter besonderer Berücksichtigung der Linguistik wird eine Theorie herausgearbeitet, durch die die zentrale Frage der Anstiftung beantwortet werden kann: Welche tatsächlichen Faktoren sind notwendig, um den Tatentschluss zu wecken? Des Weiteren wird ein Vergleichsmaßstab der Linguistik herangezogen, um sämtliche Arten der sanktionsbewehrten Einflussnahme im StGB zu systematisieren. Bestehende Abgrenzungsschwierigkeiten auf Tatbestands- und Konkurrenzebene lassen sich hierdurch innovativ lösen.
Das StGB enthält eine Vielzahl von Vorschriften, die die psychische Einflussnahme auf andere Personen sanktionieren, wobei der Tatbestand der Anstiftung die Zentralnorm bildet. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Streit um das Handlungsunrecht der Anstiftung durch einen interdisziplinären Denkansatz zu lösen. Hierbei werden in die Wortlautauslegung Erkenntnisse der linguistischen Teildisziplin der Pragmatik einbezogen. Die vorliegend vertretene Anstiftungstheorie bildet die Verhaltensweise des Anstifters daher in originärer Weise unter Beachtung linguistischer, psychologischer und soziologischer Faktoren ab. Im Weiteren ist es gelungen einen Vergleichsmaßstab der Linguistik zu nutzen, um sämtliche Arten der sanktionsbewehrten Einflussnahme im StGB zu systematisieren. Auf diese Weise lassen sich Abgrenzungsschwierigkeiten auf Tatbestands- und Konkurrenzebene innovativ lösen.
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
Kapitel 1: Das Merkmal des »Bestimmens« in § 26
Die Herausbildung der heutigen Anstiftungstheorien - Die grammatikalische Auslegung des Bestimmens in § 26 - Die Lehre vom Sprechakt - Vereinbarkeit der Anstiftungstheorien mit dem Ergebnis der Pragmatik - Der einseitig normative Erwartungsfaktor der Anstiftung - Die psychologischen Wirkmechanismen - Die systematische Auslegung - Die teleologische Auslegung - Die Probleme der Konkretisierung im Rahmen der Anstiftung
Kapitel 2: Das Merkmal des »Bestimmens« im Besonderen Teil
Das Bestimmen im Bereich des Sexualstrafrechts, in § 216 Abs. 1, in § 334 Abs. 3
Kapitel 3: Das Merkmal des »Aufforderns«
Der Wortlaut des § 111 - Sprachwissenschaftliche Analyse - Die besondere Gefährlichkeit des § 111 - Die gruppendynamischen Effekte - Die unabsehbare Streubreite der öffentlichen Aufforderung - Die Konkretisierung der Haupttat sowie des Rezipientenkreises
Kapitel 4: Das Merkmal des »Auf stachelns«
Der Wortlaut des § 130 Abs. 1 Nr. 1 - Sprachwissenschaftliche Analyse - Die teleologische Auslegung der Norm - Das geschützte Rechtsgut des § 130 Abs. 1 - Die Deliktsnatur des § 130 Abs. 1 - Das Merkmal des »Aufstachelns zum Hass« - Historie und heutige Definition - Hitlers Rhetorik - Das Konkurrenzverhältnis der Normen
Kapitel 5: Das Merkmal des »Verleitens«
Der Begriff »Verleiten« - Die sprachwissenschaftliche Analyse - Das »Verleiten« in § 357, § 160, § 120, § 328 Abs. 2 Nr. 4, § 323b
Kapitel 6: Das Merkmal des »Einwirkens«
Der Begriff »Einwirken« - Die sprachwissenschaftliche Analyse - Das Merkmal »Einwirken« in § 176 Abs. 4 Nr. 3 und 4, § 125 Abs. 1, § 89 Abs. 1
Kapitel 7: Das Merkmal des »Anleitung Gebens«
Der Begriff des »Anleitens« - Die sprachwissenschaftliche Analyse - Der gesetzliche Kontext des § 130a
Kapitel 8: Die Merkmale des »Billigens« und des »Belohnens«
Die Begriffe »Billigen und Belohnen« - Die sprachwissenschaftliche Analyse - Der gesetzliche Kontext des §§ 140 Nr. 1 u. 2, 130 Abs. 3 u. 4
Zusammenfassung
Literatur- und Sachwortverzeichnis